
DiskursGlossar
Dehumanisierung vs. Anthropomorphisierung
Kategorie: Verschiebungen
Verwandte Ausdrücke: Entmenschlichung, Vermenschlichung, Anthropomorphisierung
Siehe auch: Freund- und Feind-Begriffe
Autorin: Nina Kalwa
Version: 1.0 / Datum: 07.10.2025
Kurzzusammenfassung
Mit Dehumanisierung bzw. Anthropomorphisierung werden solche kommunikativen Techniken und Praktiken bezeichnet, die Personen, Sachverhalten oder Gegenständen menschliche Eigenschaften ab- bzw. zusprechen. Dehumanisierung und Anthropomorphisierung können sowohl durch sprachliche Mittel als auch durch andere, z. B. bildliche, Zeichen vollzogen werden.
Praktiken und Techniken der Dehumanisierung sind vor allem dadurch gekennzeichnet, dass Menschen oder Artefakten, denen zuvor menschliche Eigenschaften attribuiert wurden, menschliche Eigenschaften abgesprochen werden, zum Beispiel indem ihnen Eigenschaften von Tieren oder Gegenständen zugeschrieben werden.
Dehumanisierung von Personen und Kollektiven durch sprachliche Mittel zum Zweck der Abwertung stellt eine Form der sprachlichen Gewalt dar. Anthropomorphisierung ist dagegen dadurch gekennzeichnet, dass Gegenständen oder Tieren menschliche Eigenschaften zugesprochen werden, sodass sie als menschenähnlich wahrgenommen werden.
Erweiterte Begriffsklärung
Sowohl Dehumanisierungen als auch Anthropomorphisierungen sind nur aufgrund bestimmter Vorstellungen vom Menschen erkennbar (vgl. Haslam 2006: 252), sie richten sich somit an bestimmten Menschenbildern, an Annahmen, wie der Mensch naturgegeben sei, oder an Annahmen über Eigenschaften, die allein dem Menschen eigen seien, aus. Dehumanisierung kann als ein analytisches Konzept verstanden werden, das in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen bearbeitet wird. Weißmann (2015: 80 ff.) bespricht etwa Dehumanisierung mit Bezug auf Genozide sowohl als sozialpsychologisches als auch als (organisations-)soziologisches Konzept. Innerhalb sozialpsychologischer Forschung werden nach Weißmann (2015) etwa Massaker im Rahmen von Genoziden damit erklärt, dass Täter psychische Prozesse durchlaufen haben, welche natürliche Hemmungen beim Töten anderer Menschen zum Beispiel durch Dehumanisierungen neutralisieren (vgl. Weißmann 2015: 80). Zu diesen Erklärungen äußert Weißmann zugleich soziologische Zweifel und merkt an, dass, indem man Genozide mit solchen Dehumanisierungspraktiken erklärt, das „menschliche Zerstörungspotential unterschätzt“ werde (Weißmann 2015: 82). Bei der Betrachtung von Dehumanisierung aus soziologischer Perspektive hebt Weißmann (2015: 86) auch solche Prozesse sozialer Dehumanisierung hervor, bei der „das potentielle Opfer auf der Ebene der kommunikativen Praxis und des sozialen Handelns aus dem Bereich des Menschlichen ausgegrenzt wird“. Diese Ausgrenzung könne einerseits in Form von Entmenschlichung in der Kommunikation vollzogen werden, andererseits aber auch wenn ihnen kein gleichwertiges Teilhaberecht an Kommunikation zugesprochen wird (vgl. Weißmann 2015: 86).
Dehumanisierung von Menschen durch sprachliche Praktiken lässt sich neben Diffamierung, Degradierung und Diskriminierung in bestimmten Kontexten dem Phänomen der sprachlichen Gewalt zuordnen (vgl. Spieß 2022: 124). Das gilt häufig für politische und kommunikationsstrategische Kontexte, wenn durch die Absprache menschlicher Eigenschaften eine abwertende Perspektive eingenommen wird (im Unterschied etwa für sprachliche Aufwertungen: Sie ist ein Tiger / der Bürgermeister ist ein Löwe / er arbeitet wie eine Maschine u. ä.).
Mathias (2015: 98) unterscheidet verschiedene Formen der expliziten sprachlichen Dehumanisierung. Eine explizite sprachliche Dehumanisierung liege etwa dann vor, wenn Menschen bzw. soziale Gruppen von Menschen mit signifizierenden Zeichen versehen werden, die im Verständnis (Semantik) einer Sprechergemeinschaft entweder einen anderen Referenten als den Menschen denotieren (z. B. Tiere, Krankheiten, Pflanzen, Naturphänomene oder Gegenstände) und somit vorwiegend metaphorischer Natur sind. Beispiele hierfür sind „pejorative Tiersymboliken in judenfeindlichen Diskursfragmenten“ , wie sie in der „neueren und jüngsten Geschichte im deutschen Sprachraum vorkommen“ (Urban 2018: 13). Mathias (2015: 98) hebt aber auch solche expliziten Formen sprachlicher Dehumanisierung hervor, die durch die Verwendung bestimmter Ausdrücke entstehen, „die in einer entsprechenden Relation zum bezeichneten menschlichen Referenten stehen“ (z. B. ‚indiskrete‘ Körperteile) oder aber „Körperausscheidungen jeder Art“. Die Funktionen und Auswirkungen von Dehumanisierungen können unterschiedlich gravierend sein. Extreme Formen und Auswirkungen der Dehumanisierung fanden sich in der nationalsozialistischen Propaganda (1927–1945), in denen Juden grundsätzliche menschliche Eigenschaften abgesprochen wurden (vgl. Landry et al. 2022). Dagegen wird im Bereich der Medizin Dehumanisierung teilweise als notwendige Bewältigungsstrategie im Umgang mit Sterbenden betrachtet (vgl. Schulman-Green 2003). Dehumanisierungen konstituieren immer eine Asymmetrie zwischen Dehumanisierenden als Abwertenden und Dehumanisierten als Abgewerteten. Nick Haslam (2006, 252 ff.) unterscheidet verschiedene Domänen, in denen Dehumanisierungen vollzogen werden, wie Ethnizität, Gender und Pornographie, Invalidität, Medizin, Technologie und weitere.
Haslam (2006) hat ein integratives Modell der Dehumanisierung entwickelt, bei dem zwischen zwei Formen der Dehumanisierung unterschieden wird. Beide Formen setzen eine bestimmte Vorstellung des Menschseins voraus, die schließlich einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen abgesprochen werden. Haslam (2006: 257 f.) differenziert auf Basis von Vorarbeiten zwischen Eigenschaften, die einzigartig menschlich sind (wie moralisches Empfinden und Rationalität) und Eigenschaften, die die menschliche Natur ausmachen (wie z. B. Agentivität). Diese Unterscheidungen in „Human Uniqueness“ und „Human Nature“ führt für Haslam (2006: 257) dann auch zu unterschiedlichen Formen der Dehumanisierung. Lind (2024: 349) deutet Haslams Modell der Dehumanisierung schließlich als „Negativ-Vorlage für ein Modell der Anthropomorphisierung“ um und geht mit Bezug auf die Anthropomorphisierung von Sprachassistenzsystemen davon aus, „dass die Zuschreibung menschlicher Merkmale sowohl auf lexikalisch-semantischer als auch auf syntaktisch-struktureller Ebene“ erfolgen kann. Nach Fuchs (2021: 348) führt die Anthropomorphisierung von künstlichen Systemen wiederum zu einer Dehumanisierung des menschlichen Bewusstseins, das „vielen heute nur noch als eine Summe von Algorithmen, eine komplexe Datenstruktur im Gehirn, die im Prinzip auch von elektronischen Systemen realisiert werden könnte“ erscheine und „nicht mehr an den lebendigen Körper gebunden ist.“
Insgesamt ist die Anthropomorphisierung bezogen auf sogenannte Künstliche Intelligenz bzw. große Sprachmodelle in den vergangenen Jahren vielfach diskutiert worden (vgl. z. B. Salles et al. 2020, Fuchs 2021, Felder/Kückelhaus 2025). Fuchs (2021: 348) stellt heraus, dass es nahezu keine menschlichen Fähigkeiten mehr gebe, „die künstlichen Systemen nicht schon jetzt zugeschrieben werden: Wahrnehmen, Erkennen, Denken, Schlussfolgern, Bewerten oder Entscheiden.“ Mit der Anthropomorphisierung von KI-Systemen geht nach Fuchs (2021: 348) wiederum eine Dehumanisierung bezogen auf das menschliche Bewusstsein einher.
Beispiele
(1) Dehumanisierung in Zusammenhang mit Migration
Innerhalb von Migrationsdiskursen werden sprachliche Praktiken der Dehumanisierung von Einzelakteuren vollzogen. So spricht etwa Thilo Sarrazin in seinem Buch „Deutschland schafft sich ab“ bezogen auf muslimische Frauen von Importbräuten (Sarrazin 2010: 288) und spricht den Frauen damit Eigenschaften von Waren zu (vgl. Kalwa 2013: 282). Im Zusammenhang mit Migration werden sprachliche Praktiken auch zur Legitimation politischer Entscheidungen verwendet, etwa wenn in Bezeichnungen für zu verabschiedende Gesetze Wassermetaphoriken verwendet werden, die Migration als Naturkatastrophe konstituieren (z. B. das von Friedrich Merz im Januar 2025 zur Abstimmung gestellte Zustrombegrenzungsgesetz).
(2) Dehumanisierungen im Zusammenhang mit Antisemitismus
Monika Urban (2018) beschreibt in ihrem Buch verschiedene Bezeichnungen aus dem Bereich der Tiermetaphorik zur Abwertung von Juden und Jüdinnen im 19. und 20. Jahrhundert (auch nach Ende des NS-Regimes). Sie zeigt dabei auf, wie diese Tiersymboliken zur Konzeptualisierung des Anderen fungieren, das zur Höherbewertung des Eigenen führt. Urban unterscheidet zum Beispiel zwischen ‚uneigentlichen‘ (zum Beispiel Teufel, Dämon oder Ungeheuer), ‚höheren‘ (z. B. Schwein, Sau oder (Blut-)Hund) und ‚niederen‘ Tieren (z. B. Ratte oder Schlange). Auch Timo Büchner weist auf antisemitische Tiermetaphern wie Parasit und Ungeziefer in der Musik des Rechtsrocks hin. Dehumanisierende Sprache im Allgemeinen, die heute in unterschiedlichen Kontexten in Erscheinung tritt, hat laut Büchner sowohl mit extrem rechter Ideologie, aber auch mit den Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft zu tun und sei als Alarmsignal zu werten (vgl. Büchner 2022: 208; vgl. auch Freund-Feind-Begriffe).
(3) Vermenschlichung von Maschinen
Vermenschlichungen (Anthropomorphisierungen) finden sich häufig im Zusammenhang mit sogenannter Künstlicher Intelligenz, und zwar bezogen auf sprachliche wie auch auf bildliche Zeichen. Der Online-Blog notmyrobot weist auf verschiedene vermenschlichende Bilder von künstlicher Intelligenz hin (https://notmyrobot.home.blog). Verschiedene Ausdrücke wie lernen, Bewusstsein, reasoning im Kontext des Ausdrucks Künstliche Intelligenz lassen diese menschlich erscheinen. Teilweise werden Künstlicher Intelligenz metaphorisch sogar Krankheitssymptome zugeschrieben, wie etwa im Texttitel ChatGPT auf der Couch:
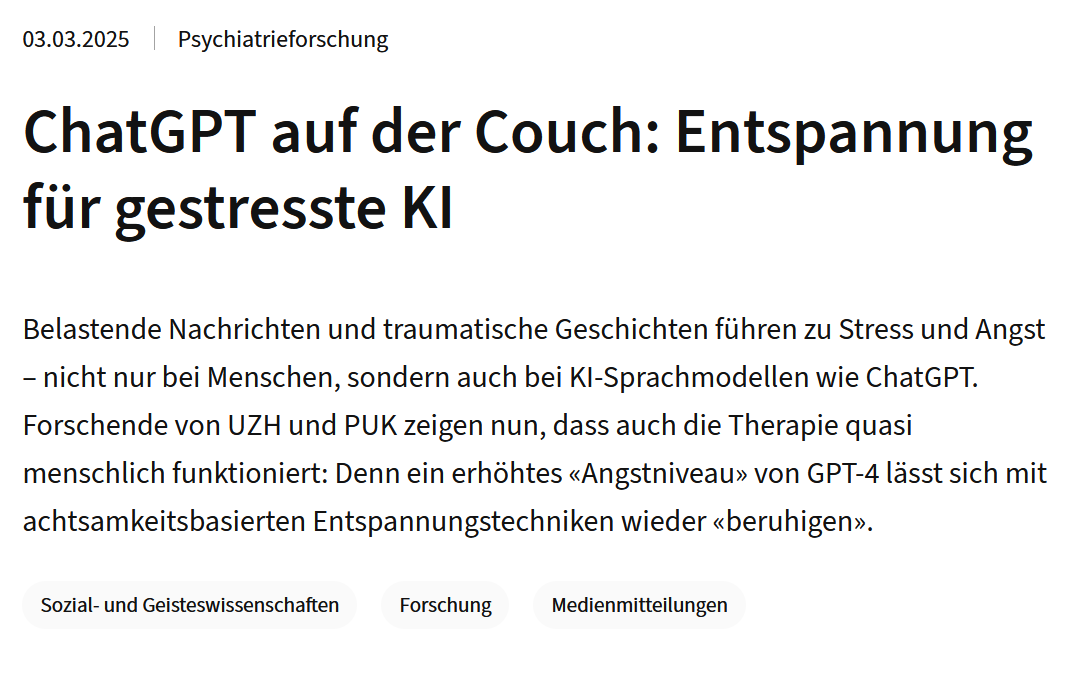
Abb. 1: Online-Artikel ChatGPT auf der Couch: Entspannung für gestresste KI (UZH 2025).
Literatur
Zum Weiterlesen
-
Haslam, Nick (2006): Dehumanization: An Integrative Review. In: Personality and Social Psychology Review, Jg. 10, Heft 3, S. 252–264.
-
Urban, Monika (2018): Von Ratten, Schmeißfliegen und Heuschrecken. Judenfeindliche Tiersymbolisierungen und die postfaschistischen Grenzen des Sagbaren. Köln: Herbert von Halem Verlag.
Zitierte Literatur
- @notmyrobots (o. J.): Welcome. Online unter: https://notmyrobot.home.blog ; Zugriff: 20.08.2025.
- Büchner, Timo (2022): „Reißt die Schlangenbrut vom Thron!“ Antisemitische Tiermetaphern im Rechtsrock. In: Kanitz, Maria; Geck, Lukas (Hrsg.): Klaviatur des Hasses. Antisemitismus in der Musik. Baden-Baden: Nomos, S. 189–213.
- Felder, Ekkehard; Kückelhaus, Marcel (2025): Das definierende Sprachmodell (LLM): Anthropomorphisierung in der Mensch-Maschine-Interaktion. In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Jg. 55, S. 431–448.
- Fuchs, Thomas (2021): Menschliche und künstliche Intelligenz. Ein kritischer Vergleich. In: Holm-Hadulla, Rainer M.; Funke, Joachim; Wink, Michael (Hrsg.): Intelligenz: Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen. Heidelberg: University Publishing, S. 347–362.
- Haslam, Nick (2006): Dehumanization: An Integrative Review. In: Personality and Social Psychology Review, Jg. 10, Heft 3, S. 252–264.
- Kalwa, Nina (2013): Das Konzept „Islam“. Eine diskurslinguistische Untersuchung. Berlin, Boston: De Gruyter.
- Landry, Alexander P.; Orr, Ram I.; Mere, Kayla (2022): Dehumanization and mass violence: A study of mental state language in Nazi propaganda (1927–1945). In: PLOS ONE, Jg. 17, Heft 11, e0274957.
- Lind, Miriam (2022): „Alexa, 3, Sprachassistentin, hat die Religion für sich entdeckt“ – Die sprachliche Anthropomorphisierung von Assistenzsystemen. In: Lind, Miriam (Hrsg.): Mensch – Tier – Maschine. Sprachliche Praktiken an und jenseits der Außengrenze des Humanen. Bielefeld: transcript, S. 347–370.
- Mathias, Alexa (2015): Metaphern zur Dehumanisierung von Feindbildern. Eine korpuslinguistische Untersuchung zum Sprachgebrauch in rechtsextremen Musikszenen. Frankfurt a. M. (u. a.): Peter Lang.
- Salles, Arleen; Evers, Kathinka; Farisco, Michele (2020): Anthropomorphism in AI. In: AJOB Neuroscience, Jg. 11, Heft 2, S. 88–95.
- Sarrazin, Thilo (2010): Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen. München: Deutsche Verlags-Anstalt.
- Schulman-Green, Dena (2003): Coping Mechanisms of Physicians Who Routinely Work with Dying Patients. In: OMEGA – Journal of Death and Dying, Jg. 47, Heft 3, S. 253–264.
- Spieß, Constanze (2022): Dehumanisierungsstrategien im öffentlich-politischen Bioethikdiskurs um Präimplantationsdiagnostik. In: Lind, Miriam (Hrsg.): Mensch – Tier – Maschine. Sprachliche Praktiken an und jenseits der Außengrenze des Humanen. Bielefeld: transcript, S. 121–147.
- Universität Zürich (2025): ChatGPT auf der Couch: Entspannung für gestresste KI. Vom 03.03.2025. Online unter: https://www.news.uzh.ch/de/articles/media/2025/KI-Therapie.html ; Zugriff: 20.08.2025.
- Urban, Monika (2018): Von Ratten, Schmeißfliegen und Heuschrecken. Judenfeindliche Tiersymbolisierungen und die postfaschistischen Grenzen des Sagbaren. Köln: Herbert von Halem Verlag.
- Weißmann, Martin (2015): Organisierte Entmenschlichung. Zur Produktion, Funktion und Ersetzbarkeit sozialer und psychischer Dehumanisierung in Genoziden. In: Gruber, Alexander; Kühl, Stefan (Hrsg.): Soziologische Analysen des Holocaust. Wiesbaden: Springer VS, S. 79–128.
Abbildungsverzeichnis
- Abb. 1: Universität Zürich (2025): ChatGPT auf der Couch: Entspannung für gestresste KI. Vom 03.03.2025. Online unter: https://www.news.uzh.ch/de/articles/media/2025/KI-Therapie.html ; Zugriff: 20.08.2025.
Zitiervorschlag
Kalwa, Nina (2025): Dehumanisierung. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 07.10.2025. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/dehumanisierung/.
DiskursGlossar
Grundbegriffe
Begriffsgeschichte
Die Begriffsgeschichte lässt sich allgemein als eine historische Methode beschreiben, die den zeitlichen Wandel der Bedeutungen von bestimmten Ausdrücken untersucht. Da einzelne Worte nie isoliert begegnen und ihre jeweiligen Bedeutungen erst im Kontext größerer sprachlicher Zusammenhänge oder semantischer Felder greifbar werden, verbindet sie sich flexibel mit anderen Methoden historischer Semantik, wie etwa der Diskursgeschichte, der Argumentationsgeschichte oder der Metaphernforschung (Metaphorologie).
Diskurssemantische Verschiebung
Mit dem Begriff der diskurssemantischen Verschiebung wird in der Diskursforschung ein Wandel in der öffentlichen Sprache und Kommunikation verstanden, der auf mittel- oder län-gerfristige Veränderung des Denkens, Handelns und/oder Fühlens größerer Gesellschafts-gruppen hinweist.
Domäne
Der Begriff der Domäne ist aus der soziologisch orientierten Sprachforschung in die Diskursforschung übernommen worden. Hier wird der Begriff dafür verwendet, um Muster im Sprachgebrauch und kollektiven Denken von sozialen Gruppen nach situationsübergreifenden Tätigkeitsbereichen zu sortieren.
Positionieren
Positionieren ist Grundbestandteil menschlicher Kommunikation. Wann immer wir miteinander interagieren und kommunizieren, bringen wir uns selbst, andere und die Objekte, über die wir sprechen, in bestimmte Relationen zueinander.
Deutungsmuster
Unter einem Deutungsmuster wird die problem- und lösungsbezogene Interpretation gesellschaftlicher und politischer Tatbestände verstanden, die Aussicht auf Akzeptanz in sozialen Gruppen hat. Der Begriff des Deutungsmusters hat Ähnlichkeit mit den Begriffen der Theorie und Ideologie. Meist werden gesellschaftlich verbreitete Leitdeutungen, die oft mit Schlagwörtern und Argumentationsmustern einhergehen (wie Globalisierung, Kapitalismus, Leistungsgesellschaft, Chancengleichheit etc.) als Beispiele für Deutungsmuster genannt.
Sinnformel
‚Wer sind wir? Woher kommen, wo stehen und wohin gehen wir? Wozu leben wir?‘ Auf diese und ähnliche existentielle Fragen geben Sinnformeln kondensierte Antworten, die in privaten wie sozialen Situationen Halt und Argumenten in politischen und medialen Debatten einen sicheren Unterbau geben können.
Praktik
Eine Praktik ist ein spezifisches, situativ vollzogenes und sinnhaftes Bündel von körperlichen Verhaltensweisen, an dem mehrere Menschen und Dinge beteiligt sein können (z. B. Seufzen, um Frust auszudrücken, oder einen Beschwerdebrief schreiben, Fußballspielen).
Kontextualisieren
Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.
Narrativ
Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.
Argumentation
Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.
Techniken
AI-Washing/KI-Washing
Unter AI-Washing ist die Praxis von Unternehmen oder Organisationen zu verstehen, Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle mit dem Etikett „Künstliche Intelligenz“ (KI bzw. „Artificial Intelligence“ (AI)) zu versehen, obwohl deren tatsächlicher Einsatz von KI-Technologien entweder stark übertrieben, nur marginal vorhanden oder überhaupt nicht gegeben ist.
Dogwhistle
Unter Dogwhistle wird in Teilen der Forschung eine doppeldeutige Äußerung verstanden, die eine offene und eine verdeckte Botschaft an jeweils eine Zuhörerschaft kommuniziert.
Boykottaufruf
Der Boykottaufruf ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, ein Ziel, also meist eine Verhaltensänderung des Boykottierten, hervorzurufen, indem zu einem Abbruch etwa der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen zu diesem aufgefordert wird.
Tabuisieren
Das Wort Tabuisierung bezeichnet die Praxis, etwas Unerwünschtes, Anstößiges oder Peinliches unsichtbar zu machen oder als nicht akzeptabel zu markieren. Das Tabuisierte gilt dann moralisch als unsagbar, unzeigbar oder unmachbar.
Aus dem Zusammenhang reißen
Das Aus-dem-Zusammenhang-Reißen gehört in den Funktionskreis der Redewiedergabe bzw. der Wiedergabe kommunikativer Ereignisse. Es kann (1) als intentionale argumentativ-polemische Strategie für ganz unterschiedliche diskursive Zielsetzungen von Akteuren genutzt werden, oder (2) es kann SprecherInnen und SchreiberInnen in unbeabsichtigter, fehlerhafter Weise unterlaufen.
Lobbying
Lobbying ist eine Form strategischer Kommunikation, die sich primär an Akteure in der Politik richtet. Beim Lobbying wird ein Bündel von kommunikativen Tätigkeiten mit dem Ziel eingesetzt, die Entscheidungen von Personen mit politischem Mandat oder den Entstehungsprozess von neuen Gesetzestexten interessengeleitet zu beeinflussen.
Karten
Karten dienen dazu, Raumausschnitte im Hinblick auf ausgewählte Charakteristika so darzustellen, dass die Informationen unmittelbar in ihrem Zusammenhang erfasst und gut kommuniziert werden können. Dazu ist es notwendig, Daten und Darstellungsweisen auszuwählen und komplexe und oft umkämpfte Prozesse der Wirklichkeit in einfachen Darstellungen zu fixieren.
Pressemitteilung
Pressemitteilungen sind standardisierte Mitteilungen von Organisationen, die sich an Journalist:innen und andere Multiplikator:innen richten. Sie dienen der offiziellen und zitierfähigen Informationsweitergabe und übernehmen zugleich strategische Funktionen in der öffentlichen Kommunikation und Meinungssteuerung.
Shitstorm
Der Begriff Shitstorm beschreibt eine relativ junge Diskurskonstellation, die seit den 2010er Jahren an Bedeutung gewonnen hat und gemeinhin als Online-Wutausbruch bezeichnet wer-den kann.
Tarnschrift
Als Tarnschrift bezeichnet man unter den Bedingungen von Zensur und Verfolgungsrisiko veröffentliche Texte, die insbesondere in der strategischen Kommunikation des NS-Widerstands eine zentrale Rolle spielten.
Schlagwörter
Brückentechnologie
Ganz allgemein wird unter dem Schlagwort der Brückentechnologie sowohl in den öffentlichen Medien als auch in technisch und wirtschaftlich dominierten Kontexten eine Technologie verstanden, die zeitlich befristet eingesetzt werden soll, bevor in Zukunft der Übergang zu einer als sinnvoller eingeschätzten anderen Technologie möglich ist.
Deindustrialisierung
Der Ausdruck Deindustrialisierung (auch De-Industrialisierung oder als Verb deindustrialisieren) beschreibt im öffentlichen Sprachgebrauch eine negativ bewertete Form des Strukturwandels durch Rückgang von produzierendem Gewerbe.
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit als ein Schlagwort des öffentlichen Diskurses bezieht sich ganz allgemein auf einen ressourcenschonenderen Umgang mit dem, was uns Menschen der Planet Erde bietet, mit dem Ziel, dass auch nachfolgende Generationen noch die Möglichkeit haben, ähnlich gut zu leben wie wir heute (Generationengerechtigkeit).
Echokammer
Der Begriff der Echokammer steht in seiner heutigen Verwendung vor allem im Zusammenhang mit der Nutzung Sozialer Medien. Er verweist metaphorisch auf einen digitalen Kommunikations- und Resonanzraum, in dem Mediennutzer*innen lediglich Inhalten begegnen, die ihre eigenen, bereits bestehenden Ansichten bestätigen, während abweichende Perspektiven und Meinungen ausgeblendet bzw. abgelehnt werden.
Relativieren
Der Ausdruck relativieren besitzt zwei zentrale Bedeutungsvarianten: In bildungssprachlichen und wissenschaftlichen Kontexten bezeichnet er eine analytische Praxis, bei der Aussagen, Begriffe oder Phänomene durch Bezugnahme auf andere Sachverhalte eingeordnet, differen-ziert und in ihrer Geltung präzisiert werden.
Massendemokratie
Geprägt wurde der Begriff Massendemokratie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von völkisch-konservativen Akteuren (prominent darunter Carl Schmitt 1926). Der Ausdruck Masse hatte damals bei den bürgerlichen Eliten eine rundum bedrohliche Assoziation.
Social Bots
Als Social Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die in der Lage sind, in sozialen Medien Kommunikation menschlicher Nutzer*innen (teilweise) automatisiert nachzuahmen.
Kriegsmüdigkeit
Der Ausdruck Kriegsmüdigkeit bezeichnet die emotionale und physische Erschöpfung von Menschen, die einen Krieg erleben, sowie die gesellschaftliche und politische Ermüdung angesichts langanhaltender Konflikte. Er beschreibt den sinkenden Kampfeswillen bei Kriegsparteien und heute wird er auch für das wachsende Desinteresse an Kriegsthemen in Medien und Öffentlichkeit genutzt.
Woke
Der Ausdruck woke stammt aus dem afroamerikanischen Englisch und bezeichnete dort zunächst den Bewusstseinszustand der Aufgeklärtheit über die Verbreitung von rassistischen Vorurteilen und Diskriminierung unter Angehörigen ethnischer Minderheiten.
Identität
Unter Identität versteht man allgemein die Summe von Merkmalen, die Individuen oder sozialen Kollektiven – etwa Nationen, Organisationen oder sozialen Gruppen – als charakteristisch oder gar als angeboren zugeordnet werden.
Verschiebungen
Kriminalisierung
Kriminalität meint ein Verhalten, das gegen ein Gesetz verstößt. Folglich bedeutet Kriminalisierung im engeren Sinne den Vorgang, durch den Verhalten ungesetzlich gemacht wird – indem Gesetze geschaffen werden.
Versicherheitlichung
In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.
Ökonomisierung
Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren
Moralisierung
Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.
Konstellationen
Krise
Krise ist vom Wort mit fachsprachlicher Bedeutung zur Zeitdiagnose und einem zentralen Begriff der öffentlich-politischen Kommunikation geworden. Der öffentlich-politische Krisenbegriff ist dabei – unabhängig vom Gegenstand der Krise – in eine krisendiskurstypische Konstellation zur Begründung von krisenüberwindenden Handlungen eingebettet.
Partizipatorischer Diskurs
Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.
Skandal
Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.
DiskursReview
Review-Artikel
Wenn ein Wort Geschichte macht: Die ‚Zeitenwende‘ im politischen und medialen Diskurs
Manche Worte bleiben haften. Kaum ein politisches Wort hat die deutschsprachige Öffentlichkeit seit 2022 so geprägt wie der Begriff „Zeitenwende“. Bundeskanzler Olaf Scholz verwendete ihn in seiner Regierungserklärung am 27. Februar 2022 unmittelbar nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine und erklärte: „Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.“ (Scholz, Regierungserklärung). Dieser Begriff löste ein bemerkenswertes Echo aus, er …
Wenn aus Vielen Einer wird – Warum pauschale Nationsbezeichnungen sprachlich gefährlich sind
„In dieser Situation sind die Deutschen sehr unzufrieden mit der Arbeit der Politik.“ (Kinkartz, 2025), schreibt die Deutsche Welle im November 2025. Gemeint ist dabei keine einzelne Person oder klar definierte Gruppe, sondern eine ganze Nation, welche mit einem einzigen Artikel zu einem scheinbar einheitlichen Kollektiv zusammengefasst wurde. Solche Formulierungen sind kein Einzelfall. Ähnliche Beispiele, wie „Die Russen greifen an vielen Stellen an“ (Die Welt am Morgen, 2024), „Die Ukrainer …
Sprachkritische Auseinandersetzung im Streit um pflanzliche Ersatzprodukte
“Die Wurst als Waffe” mit solchen oder ähnlichen polarisierenden Schlagzeilen berichten die ZEIT und andere Zeitungen über den Beschluss des Europaparlaments zur Verwendung der Namen veganer Fleischersatzprodukte.1 Begriffe wie “Wurst”, “Schnitzel” oder ”Milch” sollen künftig nur Lebensmittel tragen dürfen, welche tierische Inhaltsstoffe enthalten. In der Abstimmung vom achten Oktober 2025 stimmten 355 der 602 Mitglieder des Parlaments dem Vorschlag zu.2 Auch wenn die Abstimmung nicht automatisch …
Ästhetik als Politisches Argument
Der Begriff Stadtbild erscheint im öffentlichen Diskurs häufig als scheinbar neutrale Beschreibung eines räumlichen Zustands. Ursprünglich bezeichnete er das äußere Erscheinungsbild von Architektur, Straßenräumen und historischen Bereichen (Wikipedia 2025). In letzter Zeit taucht der Begriff zunehmend in Diskussionen auf, die soziale und kulturelle Themen betreffen. Diese Verschiebung zeigt sich deutlich in der jüngsten politischen Debatte um Friedrich Merz, der erklärte: „Wir haben natürlich immer …
„Fake news“- ein Etikett statt eines Arguments?
In den letzten Jahren haben „Fake News“ enorme Auswirkungen auf den politischen Dialog gehabt. Sie werden überall in Wahlkämpfen, Medien und alltäglichen Kommunikationen verwendet, um Informationen zu diskreditieren, sei es journalistisches Material, wissenschaftliche Fakten oder politische Ansichten. Trotz der scheinbaren Neutralität ist dieser Ausdruck tatsächlich ein Werkzeug, um einer Diskussion auszuweichen, damit der Sprecher vermeiden kann, dass er das Wesen der Nachricht verstehen müsste, …
Memes als moderne Propaganda – Eine sprach- und medienkritische Untersuchung
Digitale Kommunikationsformen prägen heutige gesellschaftliche Debatten weitaus stärker als die klassischen Medien. Ihr Einfluss auf die politische Meinungsbildung und die Ausbildung ideologischer Positionen ist inzwischen unverkennbar und zählt zu den markantesten Entwicklungen der digitalen Gegenwart. Besonders hervorzuheben sind Memes: Sie verbreiten sich schnell, arbeiten mit humoristischen Mitteln und verdichten komplexe Inhalte auf ein Minimum an Zeichen. In öffentlichen Diskursen werden sie daher nicht mehr als spielerisches Internetphänomen betrachtet, sondern als ernstzunehmendes Instrument politischer Kommunikation und den damit einhergehenden propagandistischen Strategien.
„Stadtbild“ – Eine gedankliche Chiffre im politischen Diskurs
Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte, und wiederholte, er habe gar nichts zurückzunehmen und wolle an dieser Politik festhalten
Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?
Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.
Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament
Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)
Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit
DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...
