
DiskursGlossar
Memes
Kategorie: Techniken
Verwandte Ausdrücke: Meme, Internet-Meme, Virales Bild, Bild Makro, Image Macro
Siehe auch: Schlagbilder, Kollektivsymbol
Autoren: Lars Bülow, Michael Johann
Version: 1.3 / Datum: 15.08.2022
Kurzzusammenfassung
Der Begriff des Internet-Memes fasst eine relativ heterogene Gruppe digitaler – und zumeist multimodaler – Texte zusammen (zum Beispiel Videos, GIFs, Image Macros), die sich durch formale oder inhaltliche Gemeinsamkeiten auszeichnen und durch Imitations- und Aneignungsprozesse verbreiten. Mitunter spielt auch die gemeinsame Positionierung zu bestimmten Themen eine wichtige Rolle. Daher können Internet-Memes oftmals als kollektiver Ausdruck der Netzgemeinde verstanden werden. In ihnen manifestiert sich ein soziales und kulturelles Bewusstsein, in dem sich allgemeine Denkweisen, Diskurse und Positionierungspraktiken widerspiegeln. Internet-Memes sind ein Format, das sich auf den Plattformen der sozialen Medien wie Instagram, Facebook, TikTok oder Twitter großer Beliebtheit erfreut und als kommunikative Praxis fest etabliert hat. Einige Plattformen haben sich mehr oder weniger auf Memes spezialisiert, etwa KnowYourMeme, Imgflip oder Imgur.
Internet-Memes spielen insbesondere in der politischen Sphäre zunehmend eine wichtige Rolle. Die strategische Nutzung läuft dem spontanen, ungezwungenen und kollektiven Charakter von Memes allerdings oftmals zuwider, da diese Art der Nutzung, die durch Zentralisierung um einen strategischen Akteur herum geprägt ist, Internet-Memes planbar und steuerbar zu machen versucht. Das Verstehen- und Erstellenkönnen von Memes ist daher nicht nur seitens der Netzgemeinde wichtig, auch innerhalb der Kommunikationsabteilungen bedarf es eines geschickten Umgangs mit diesem relativ neuen Format. Gelingt die strategische Integration, haben Internet-Memes durchaus das Potenzial, andere Kommunikationsziele wie etwa den Aufbau und Ausbau einer Community und die Pflege des eigenen Images zu unterstützen.
Erweiterte Begriffsklärung
Begrifflich sind Internet-Memes (kurz Meme (Sg.), Memes (Pl.)) zunächst von sogenannten Memen (Mem (Sg.), Meme (Pl.)) abzugrenzen. Während Meme in Anlehnung an den Evolutionsbiologen Richard Dawkins (1976) das kulturelle Gegenstück zu den Genen – also zu den Replikatoren biologischer Evolutionsprozesse – darstellen, fasst der Begriff des Internet-Memes eine relativ heterogene Gruppe digitaler Artefakte zusammen (zum Beispiel Videos, GIFs, Image Macros), die sich durch formale oder inhaltliche Gemeinsamkeiten auszeichnen und durch Imitationsprozesse verbreiten. Mitunter spielt auch die gemeinsame Positionierung zu bestimmten Themen eine wichtige Rolle. Limor Shifman (2014a: 44) definiert Internet-Memes daher als
„(a) eine Gruppe digitaler Einheiten, die gemeinsame Eigenschaften im Inhalt, in der Form und/oder der Haltung aufweisen, die (b) in bewusster Auseinandersetzung mit anderen Meme[s] erzeugt und (c) von vielen Usern im Internet verbreitet, imitiert und/oder transformiert wurde.“
Auf Plattformen der sozialen Medien wie Instagram, Facebook, TikTok oder Twitter sind Internet-Memes als kommunikative Praxis fest etabliert. Es gibt allerdings auch Plattformen, die sich mehr oder weniger auf Memes spezialisiert haben. Zu nennen sind hier etwa KnowYourMeme, Reddit, Imgflip oder Imgur. Dort erscheinen Internet-Memes meist in Form von kurzen Videos, GIFs oder Bildern mit Text, weshalb sie mitunter in der Forschung aufgrund ihrer prototypischen Struktur als multimodale Kommunikate (vgl. Arens 2016), Bild-Text-Kompositionen (vgl. Oswald 2018) sowie Sprache-Bild- (vgl. Osterroth 2015) oder Bild-Sprache-Texte (vgl. Johann & Bülow 2018) gefasst werden.
Wie aus der oben zitierten Definition von Limor Shifman (2014a, 44) deutlich wird, zeichnen sich Internet-Memes auch dadurch aus, dass sie durch zahlreiche Prosument*innen über Imitations- und Aneignungsprozesse im Internet verbreitet werden. „Prosumption“ meint hier den Prozess der Verschmelzung von Produktions- und Konsumroutinen (vgl. Toffler 1980), der charakteristisch für die Kommunikation in den sozialen Medien ist. Internet-Memes sind demnach Phänomene, deren Bedeutungen und Strukturen sich durch kollektive Praktiken und Aushandlungsprozesse verfestigen (vgl. z.B. Osterroth 2015; Pauliks 2017). In ihnen manifestiert sich mitunter ein soziales und kulturelles Bewusstsein, in dem sich allgemeine Denkweisen, Diskurse und Positionierungspraktiken widerspiegeln (vgl. Zappavigna 2020).
Internet-Memes sind also mehr als nur einzelne Bilder oder Videos: Sie sind ein kollektiver Ausdruck der Netzgemeinde – und gerade in diesem mobilisierenden und partizipativen Charakter liegt ihr großes Potenzial für die strategische Kommunikation. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Internet-Memes mittlerweile besonders in der politischen Sphäre eine wichtige Rolle spielen, sowohl in der Kommunikation von Bürger*innen- bzw. Graswurzelbewegungen (Bottom-up-Kommunikation) als auch in der institutionalisierten bzw. strategisch geleiteten Abwärtskommunikation (Top-down-Kommunikation). Ihre „Anwendungspotentiale reichen dabei von der Informationsgewinnung über die Informationsvermittlung bis hin zur gezielten Persuasion oder Mobilisierung“ (Johann & Bülow 2018: 144). In der öffentlichen Kommunikation spielen sie zudem eine wichtige Rolle, da sie Gruppenidentitäten konstruieren und damit der gesellschaftlichen Abgrenzung dienen (vgl. Shifman 2014b). Aus kommunikativ-funktionaler Sicht dienen Internet-Memes also oftmals als Instrument des Meinungsausdrucks; mit ihnen lassen sich nicht nur alltägliche Situationen (humorvoll) aufarbeiten, sondern auch politische und kulturelle Ereignisse kommentieren, wodurch sich für die Prosument*innen kreative Möglichkeiten zur politischen Teilhabe ergeben (vgl. Johann 2022). Humor dient dabei häufig als Strategie zur kommunikativen Rahmung der in Internet-Memes ausgedrückten Einstellungen und Meinungen und als eine Art ‚Kitt‘ zwischen den Prosument*innen: „Humor can offer disenfranchised groups resources to critique authorities, to cope with painful experiences and to create solidarity with peers“ (Newton et al. 2022: 3).
In der Bottom-up-Kommunikation greifen die Nutzer*innen in ihren Memes häufig aktuelle politische Ereignisse oder Themen auf und kommentieren diese oftmals auf sarkastische Art. In diesem Prozess der kollektiven Positionierung fungieren Internet-Memes zumeist als Vehikel für individuelle Meinungen zu und Kritik an politischen Entwicklungen. Dadurch, dass sich die Prosument*innen mit ihren individuellen Meme-Adaptionen oftmals auch aufeinander beziehen, können Memes rasch ein mobilisierendes Potenzial entwickeln.
In der Top-down-Kommunikation sind Internet-Memes für verschiedene Akteure wie Politiker*innen oder Institutionen relevant, da sich mit ihnen komplexe Themen auf humorvolle und/oder kritische Weise herunterbrechen lassen. So zeigen zum Beispiel Geniole et al. (2022), dass in Kampagnen eingesetzte Internet-Memes sogar die Bereitschaft zur Impfung gegen COVID-19 innerhalb der Bevölkerung erhöhen können. Des Weiteren können politische Akteure mithilfe von Internet-Memes ihre Reichweite in den sozialen Medien steigern, eine eigene Community auf- und ausbauen sowie das eigene Image stärken. Diese Art der Nutzung ist jedoch nicht nur der politischen Kommunikation vorbehalten, auch in anderen Bereichen der strategischen Kommunikation (z. B. Unternehmenskommunikation, Werbung, Journalismus) ist der Einsatz von Internet-Memes zu beobachten.
Durch die Top-down-Nutzung verlieren Internet-Memes jedoch ihren kollektiven und zwanglosen Charakter. Schlecht komponierte Internet-Memes, die nicht den Zeitgeist der jeweiligen Netzgemeinde treffen oder die bestimmten Konventionen der sozio-kognitiv verankerten Meme-Literacy zuwiderlaufen, können zu negativen Reaktionen von Seiten der Prosument*innen führen. Der Begriff Meme-Literacy bringt zum Ausdruck, dass Prosument*innen durch die wiederholte Verwendung und Rezeption von Internet-Memes bestimmte Praktiken oder vielmehr Techniken verinnerlicht haben, um diese selbst ‚erfolgreich‘ zu komponieren und zu verstehen. Diese domänenspezifische Fähigkeit wird mitunter auch als „ingroup code of the digitally literate“ bezeichnet (Zenner & Geeraerts 2018: 173).
Beispiele
Die Liste an Beispielen für die Verwendung von Internet-Memes zur strategischen Kommunikation ist lang. Insbesondere ist dabei die Verwendung im politischen Kontext hervorzuheben. Die Meme-Forschung beschäftigt sich hier beispielsweise mit der Rolle von Internet-Memes für Protestbewegungen wie Occupy Wall Street (vgl. Milner 2013), bei Kampagnen gegen Rassismus (vgl. Williams 2020), Sexismus (vgl. Brantner et al. 2020) oder den Klimawandel (vgl. Ross & Rivers 2019) oder im Zusammenhang mit Delegitimierungsversuchen durch die rechte Szene (vgl. Peters & Allan 2022). Die Bandbreite an Nutzungskontexten führt deutlich vor Augen, dass die strategische Nutzung von Internet-Memes nicht an ein bestimmtes politisches Lager geknüpft ist.
(1) Wie etabliert Internet-Memes in der strategischen politischen Kommunikation sind, wird am offiziellen Twitter-Kanal der ukrainischen Regierung im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Jahr 2022 deutlich.

Abb. 1: Twitter-Meme der ukrainischen Regierung zur Delegitimierung Wladimir Putins.
Internet-Memes werden hier als Mittel zur Kommentierung aktueller Ereignisse und zur sarkastischen Delegitimierung des Kriegsgegners verwendet. Generell konnte in der Anschlusskommunikation zu den kriegerischen Auseinandersetzungen der Einsatz von Bildern und Internet-Memes als Vehikel für Desinformation in den sozialen Medien nachgewiesen werden (vgl. Msughter & Yar’Adua 2022).
(2) Auch über die Politik hinaus haben Internet-Memes Eingang in die Kommunikationsaktivitäten interessengeleiteter Akteure gefunden. So ist auch im Journalismus zu beobachten, dass Internet-Memes eine zentrale Rolle bei der Zielgruppenansprache spielen. Als Beispiel ließe sich etwa jetzt, das junge Online-Magazin der Süddeutschen Zeitung, anführen. Mit dem nachfolgenden Meme positioniert sich jetzt etwa zum Thema Hatespeech:
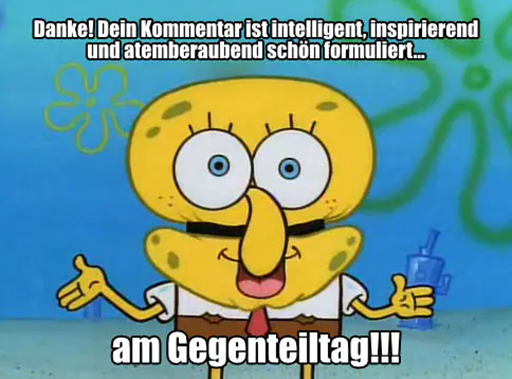
Abb. 2: Meme auf jetzt.de zum Thema Hasskommentare.
Das strategische Potenzial von Memes wurde insbesondere im Journalismus früh erkannt. Johann und Bülow (2019) konnten in einer Studie zur Diffusion von Internet-Memes auf Twitter beispielsweise herausfinden, dass Journalist*innen oft in den frühen Phasen eines Meme-Trends maßgeblich an dessen Verbreitung beteiligt sind.
(3) Neben dem Journalismus haben sich Internet-Mems auch in der Unternehmenskommunikation und in der Werbung etabliert. Exemplarisch seien hier die Memes der Automobilvermietung Sixt hervorgehoben, die zumeist satirisch und zeitnah auf Fehltritte von Spitzenpolitiker*innen reagiert – im nachfolgenden Beispiel etwa auf die Plagiatsaffäre um Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen Annalena Baerbock im Vorfeld des Bundestagswahlkampfes 2021:

Abb. 3: Meme des Unternehmens Sixt zur Plagiats-affäre um die Bundesministerin des Auswärtigen Annalena Baerbock.
Die Memes von Sixt stellen natürlich nicht nur eine Reaktion auf ein aktuelles politisches Ereignis dar, sie enthalten zeitgleich eine Werbebotschaft und dienen der Imagepflege. Die Forschung weist in diesem Zusammenhang auf die Relevanz des Zusammenspiels zwischen Sprache, Bild und der Passung zum jeweiligen Unternehmen als Erfolgsrezept hin (vgl. Chuah et al. 2020). Umgekehrt nutzen Prosument*innen Internet-Memes sowohl in der politischen Kommunikation (vgl. McKelvey et al. 2021) als auch im Journalismus (vgl. Al-Rawi et al. 2021) und in der Unternehmenskommunikation (vgl. Brubaker et al. 2018) als zielgruppenspezifischen Ausdruck von Meinungen und Einstellungen gegenüber strategischen Akteuren sowie zum Aufbau einer Gemeinschaft.
Literatur
Zum Weiterlesen
-
Bülow, Lars; Johann, Michael (Hrsg.) (2019): Politische Internet-Memes. Theoretische Herausforderungen und empirische Befunde. Berlin: Frank & Timme.
-
Denisova, Anastasia (2019): Internet Memes and Society. Social, Cultural, and Political Contexts. New York; London: Routledge Taylor & Francis Group.
-
Shifman, Limor (2014): Meme. Kunst, Kultur und Politik im digitalen Zeitalter. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
-
Von Gehlen, Dirk (2020): Meme. Digitale Bildkulturen. Berlin: Wagenbach.
Zitierte Literatur und Belege
- Al-Rawi et al. (2021): Networked flak in CNN and Fox News memes on Instagram. In: Digital Journalism, Heft 9, Jg.10, S. 1464-1481.
- Arens, Katja (2016): Bild-Makros als Motor der Facebook-Interaktion – Eine formale und interaktionale Betrachtung multimodaler Kommunikate. In: Arens, Katja; Torres Cajo, Sarah (Hrsg.): Sprache und soziale Ordnung. Studentische Beiträge zu sozialen Praktiken in der Interaktion. Münster: Mosenstein und Vannerdat, S. 127–156.
- Brantner, Cornelia; Lobinger, Katharina; Stehling, Miriam (2019): Memes against sexism? A multi-method analysis of the feminist protest hashtag #distractinglysexy and its resonance in the mainstream news media. In: Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Heft 3, Jg. 26, S. 674–696.
- Brubaker, Pamela J. et al. (2018): One does not simply meme about organizations: Exploring the content creation strategies of user-generated memes on Imgur. In: Public Relations Review, Heft 5, Jg. 44, S. 741–751.
- Chuah, Kee-Man et al. (2020): We “Meme” business: Exploring Malaysian youths’ interpretation of internet memes in social media marketing. In: International Journal of Business and Society, Heft 2, Jg. 21, S. 931–944.
- Dawkins, Richard (1976): The selfish gene. Oxford: Oxford University Press.
Geniole, Shawn N. et al. (2022): Preliminary evidence that brief exposure to vaccination-related internet memes may influence intentions to vaccinate against COVID-19. In: Computers in Human Behavior, Heft 131. - Johann, Michael (2022): Political participation in transition: Internet memes as a Form of political expression in social media. In: Studies in Communication Sciences, Heft 1, Jg. 22, S. 149–164.
- Johann, Michael; Bülow, Lars (2018): Im Anfang war das Bild. Eine diffusionstheoretische Betrachtung der Verbreitung des Merkel-Memes auf Twitter. In: Eilders, Christiane et al. (Hrsg.): Vernetzung. Stabilität und Wandel gesellschaftlicher Kommunikation. Köln: Herbert von Halem, S. 125–148.
- Johann, Michael; Bülow, Lars (2019): One does not simply create a meme: Conditions for the diffusion of internet memes. In: International Journal of Communication, Jg. 13, S. 1720–1742.
- McKelvey, Fenwick; DeJong, Scott; Frenzel, Janna (2023): Memes, scenes and #ELXN2019s: How partisans make memes during elections. New Media & Society, Heft 7, Jg. 25, S. 1626–1647.
- Milner, Ryan M. (2013): Pop polyvocality: Internet memes, public participation, and the Occupy Wall Street movement. In: International Journal of Communication, Jg. 7, S. 2357–2390.
- Msughter, Aondover E.; Yar’Adua, Suleiman M. (2022): Influence of digital images on the propagation of fake news on Twitter in Russia and Ukraine crisis. Online unter: https://ssrn.com/abstract=4062502.
- Newton, Giselle et al. (2022): More than humor: Memes as bonding icons for belonging in donor-conceived people. In: Social Media + Society, Heft 1, Jg 8, S. 1–13.
- Osterroth, Andreas: Das Internet-Meme als Sprache-Bild-Text. In: IMAGE. Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft. Heft 22, Jg. 11 (2015), Nr. 2, S. 26–46. Online unter: https://mediarep.org/bitstream/handle/doc/17348/IMAGE_22-Hauptheft_26-46_Osterroth_Internet-Meme_Sprache-Bild-Text_.pdf?sequence=2 ; Zugriff: 20.07.2023.
- Oswald, Sascha (2018): „Try not to cry“ – Memes, Männlichkeit und Emotionen: Zur Entstehung von Affektstrukturen in digitalen Bildpraktiken. In: kommunikation @ gesellschaft, Jg. 19, S. 1–29.
- Ross, Andrew S.; Rivers, Damian J. (2019): Internet memes, media frames, and the conflicting logics of climate change discourse. In: Environmental Communication, Heft 7, Jg. 13, S. 975–994.
- Pauliks, Kevin (2017): Die Serialität von Internet-Memes. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch.
- Peters, Chris & Stuart Allan (2021): Weaponizing memes: The journalistic mediation of visual politicization. Digital Journalism, Heft 2, Jg. 10, S. 217–229.
- Shifman, Limor (2014a): Meme. Kunst, Kultur und Politik im digitalen Zeitalter. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Shifman, Limor (2014b): Memes in Digital Culture. Cambridge, MA: MIT Press.
- Toffler, Alvin (1980): The Third Wave. New York: Morrow.
- Williams, Apryl (2020): Black memes matter: #LivingWhileBlack with Becky and Karen. Social Media + Society, Heft 4, Jg. 6, S. 1–14.
- Zappavigna, Michele (2020): “And then he said … No one has more respect for women than I do”. Intermodal relations and intersubjectivity in image macros. In: Stöckl, Hartmut et al. (Hrsg.): Shifts toward image-centricity in contemporary multimodal practices. New York & London: Routledge Taylor & Francis Group, S. 204–225.
- Zenner, Eline; Geeraerts, Dirk (2018): One does not simply process memes. Image macros as multimodal constructions. In: Winter-Froemel, Thaler, Verena (Hrsg.): Cultures and traditions of wordplay and wordplay research. Berlin & Boston: de Gruyter, S. 167–194.
Abbildungsverzeichnis
- Abb. 1: Twitter-Meme der ukrainischen Regierung zur Delegitimierung Wladimir Putins. URL: https://twitter.com/Ukraine/status/1530612227350401026 ; Zugriff: 11.08.2022.
- Abb. 2: Meme auf jetzt.de zum Thema Hasskommentare. URL: https://www.jetzt.de/netzteil/neue-kampagne-gegen-hate-speech ; Zugriff 11.08.2022.
- Abb. 3: Meme des Unternehmens Sixt zur Plagiatsaffäre um die Bundesministerin des Auswärtigen Annalena Baerbock. URL: https://twitter.com/sixtde/status/1413503710940991492 ; Zugriff: 11.08.2022.
Online-Quellen:
- Instagrammseite von jetzt – Das junge Magazin der Süddeutschen Zeitung. IG: jetzt_de. URL: https://www.instagram.com/jetzt_de/?hl=de.
Zitiervorschlag
Bülow, Lars und Johann, Michael (2022): Memes. In: Diskursmonitor. Glossar zur strategischen Kommunikation in öffentlichen Diskursen. Hg. von der Forschungsgruppe Diskursmonitor und Diskursintervention. Veröffentlicht am 15.08.2022. Online unter: https://diskursmonitor.de/glossar/memes/.
DiskursGlossar
Grundbegriffe
Kontextualisieren
Kontextualisieren wird im allgemeineren bildungssprachlichen Begriffsgebrauch verwendet, um das Einordnen von etwas oder jemandem in einen bestimmten Zusammenhang zu bezeichnen.
Narrativ
Mit der diskursanalytischen Kategorie des Narrativs werden Vorstellungen von komplexen Denk- und Handlungsstrukturen erfasst. Narrative in diesem Sinne gehören wie Schlagwörter, Metaphern und Topoi zu den Grundkategorien der Analyse von Diskursen.
Argumentation
Argumentation bezeichnet jene sprachliche Tätigkeit, in der man sich mithilfe von Gründen darum bemüht, die Richtigkeit einer Antwort auf eine bestimmte Frage zu erweisen. Das kann in ganz verschiedenen Situationen und Bereichen nötig sein, namentlich um eine poli-tische, wissenschaftliche, rechtliche, unternehmerische oder private Angelegenheit zu klären.
Hegemonie
Wie der britische Politikwissenschaftler Perry Anderson 2018 in einer umfassenden, historisch weit ausgreifenden Studie zum Gebrauch des Begriffs Hegemonie und seinen Konjunkturen beschreibt, liegen die historischen Wurzeln des Begriffs im Griechischen, als Bezeichnung für Führung (eines Staatswesens) mit Anteilen von Konsens.
Diskurskompetenz
Im engeren, linguistischen Sinn bezeichnet Diskurskompetenz die individuelle sprachlich-kommunikative Fähigkeit, längere zusammenhängende sprachliche Äußerungen wie Erzählungen, Erklärungen, Argumentationen zu formulieren und zu verstehen.
Agenda Setting
Rassistisch motivierte Gewalt, Zerstörung des Regenwaldes, Gender pay gap: Damit politische Institutionen solche Probleme bearbeiten, müssen sie erst als Probleme erkannt und auf die politische Tagesordnung (Agenda) gesetzt werden. Agenda Setting wird in Kommunikations- und Politikwissenschaft als eine Form strategischer Kommunikation beschrieben, mithilfe derer Themen öffentlich Gehör verschafft und politischer Druck erzeugt werden kann.
Medien
Die Begriffe Medien/Massenmedien bezeichnen diverse Mittel zur Verbreitung von Informationen und Unterhaltung sowie von Bildungsinhalten. Medien schaffen damit eine wesentliche Grundlage für Meinungsbildung und Meinungsaustausch.
Macht
Macht ist die Fähigkeit, Verhalten oder Denken von Personen zu beeinflussen. Sie ist Bestandteil sozialer Beziehungen, ist an Kommunikation gebunden und konkretisiert sich situationsabhängig. Alle expliziten und impliziten Regeln, Normen, Kräfteverhältnisse und Wissensformationen können aus diskursanalytischer Perspektive als Machtstrukturen verstanden werden, die Einfluss auf Wahrheitsansprüche und (Sprach)Handlungen in einer Gesellschaft oder Gruppe nehmen.
Metapher
In der politischen Berichterstattung ist oft davon die Rede, dass eine bestimmte Partei einen Gesetzesentwurf blockiert. Weil das Wort in diesem Zusammenhang so konventionell ist, kann man leicht übersehen, dass es sich dabei um eine Metapher handelt.
Normalismus
Normalismus ist der zentrale Fachbegriff für die Diskurstheorie des Literaturwissenschaftlers Jürgen Link. Die Normalismus-Theorie fragt danach, wie sich Vorstellungen von ‚Normalität‘ und ‚Anormalität‘ als Leit- und Ordnungskategorien moderner Gesellschaften herausgebildet haben.
Techniken
Ironie
Ironie (altgriechisch εἰρωνεία (eirōneía), wörtlich ‚Verstellung‘, ‚Vortäuschung‘) ist in unserer unmittelbaren und massenmedialen Kommunikationskultur sehr bedeutsam. Sie arbeitet mit einem Bewertungsgegensatz zwischen Gesagtem und Gemeintem.
Wiederholen
Das Wiederholen von Äußerungen in öffentlichen (politischen) Diskursen zielt darauf, das Denken anderer zu beeinflussen, Wissen zu popularisieren, einseitige (z. B. fanatisierende, beschwörende, hysterische, ablenkende, pseudosachliche) Konstruktionen von Wahrheit zu erzeugen, um die soziale Wirklichkeit als intersubjektiven Konsens im einseitigen Interesse des „Senders“ zu verändern. Grundvoraussetzung ist die Annahme, dass das kollektive Denken stets mächtiger als das individuelle Denken ist.
Diskreditieren
Das Diskreditieren ist eine Praktik, mit der Diskursakteure durch verschiedenste Strategien, die von Verunglimpfungen und Verleumdungen bis hin zu rufschädigenden Äußerungen reichen, abgewertet und herabgesetzt werden.
Nähe inszenieren
Die Inszenierung von Nähe beschreibt eine Kommunikations>>praktik, bei der Akteur:innen Techniken einsetzen, um Vertrautheit, Sympathie und Authentizität zu vermitteln (z.B. das Angebot einer:s Vorgesetzten, zu duzen).
Diplomatie
Diplomatie bezeichnet im engeren Sinne eine Form der Kommunikation zwischen offiziellen Vertretern von Staaten, die die Aufgabe haben, zwischenstaatliche Beziehungen durch und für Verhandlungen aufrecht zu erhalten. Diese Vertreter können Politiker oder Beamte, insbesondere des diplomatischen Dienstes, sowie Vertreter internationaler Organisationen sein.
Typografie
Typografie bezeichnet im modernen Gebrauch generell die Gestaltung und visuelle Darstellung von Schrift, Text und (in einem erweiterten Sinne) auch die Dokument-Gesamtgestaltung (inklusive visueller Formen wie Abbildungen, Tabellen, Taxono-mien usw.) im Bereich maschinell hergestellter Texte (sowohl im Druck als auch auf dem Bildschirm)
Fact Checking
Fact Checking ist eine kommunikationsstrategische Interventionstechnik, bei der eine Diskursaussage auf Bild oder Textbasis unter dem Gesichtspunkt der Faktizität bewertet wird. Sie ist überwiegend in journalistische Formate eingebettet, die als Faktencheck bezeichnet werden.
Distanzieren
Distanzieren bezeichnet die Abgrenzung eines individuellen oder organisationalen Akteurs von einem anderen Akteur. Eine Distanzierung kann kommunikativ oder operativ vollzogen werden, d. h. die Abgrenzung findet verbal oder unter Aufkündigung eines Arbeitsverhältnisses statt.
Kontaktschuld-Topos
« Zurück zur ArtikelübersichtKontaktschuld-Topos Kategorie: TechnikenVerwandte Ausdrücke: Assoziationsschuld, Applaus von falscher Seite, ad hominem, Guilt by AssociationSiehe auch: Verschwörungstheorie, Moralisierung, Freund-Feind-Begriffe, Topos, Opfer-ToposAutoren:...
Schlagbilder
Der Terminus Schlagbild bezeichnet mehr oder weniger inszenierte Bilder. Ihre Bedeutung beruht nicht nur auf ihren sichtbaren (ikonischen) Formen, sondern vielmehr auf den symbolischen Inhalten, die sich durch vielfache mediale Wiederholung und Konventionen gefestigt haben.
Schlagwörter
Wohlstand
Unter Wohlstand sind verschiedene Leitbilder (regulative Ideen) zu verstehen, die allgemein den Menschen, vor allem aber den Beteiligten an politischen und wissenschaftlichen Diskursen (politisch Verantwortliche, Forschende unterschiedlicher Disziplinen usw.) eine Orientierung darüber geben sollen, was ein ‚gutes Leben‘ ausmacht.
Remigration
Der Begriff Remigration hat zwei Verwendungsweisen. Zum einen wird er politisch neutral verwendet, um die Rückkehrwanderung von Emigrant:innen in ihr Herkunftsland zu bezeichnen; die meisten Verwendungen beziehen sich heute jedoch auf Rechtsaußendiskurse, wo das Wort der euphemistischen Umschreibung einer aggressiven Politik dient, mit der nicht ethnisch deutsche Immigrant:innen und ihren Nachfahr:innen zur Ausreise bewegt oder gezwungen werden sollen.
Radikalisierung
Das Adjektiv radikal ist ein mehrdeutiges Wort, das ohne spezifischen Kontext wertneutral gebraucht wird. Sprachhistorisch bezeichnete es etwas ‚tief Verwurzeltes‘ oder ‚Grundlegendes‘. Dementsprechend ist radikales Handeln auf die Ursache von etwas gerichtet, indem es beispielsweise zugrundeliegende Systeme, Strukturen oder Einstellungen infrage stellt und zu ändern sucht.
Bürokratie
Bürokratie ist ein Begriff, der im Rahmen aktueller strategischer Kommunikation ein dicht besetztes, polarisiertes Feld korrespondierender Ausdrücke öffnet. Neben den direkten Ab-leitungen Bürokratisierung, Bürokratismus und Komposita, als wichtigstes Bürokratieabbau, gehören dazu vor allem Flexibilisierung, Privatisierung, Deregulierung.
Politisch korrekt / Politische Korrektheit
Der Ausdruck politisch korrekt / Politische Korrektheit und die amerikanischen Vorbilder politically correct /P.C. / Political Correctness (Gegenteile, etwa politisch unkorrekt etc., sind mitzudenken) repräsentieren ein seit den frühen Neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts populäres Deutungsmuster, mit dem weltanschauliche, ästhetische und politische Konflikte berichtet/bewertet werden, meist zuungunsten der als politisch korrekt bezeichneten Positionen, denen man eine überzogene, sowohl lächerliche als auch gefährliche Moralisierung unterstellt.
Kipppunkt
Als öffentliches Schlagwort ist Kipppunkt Teil eines Argumentationsmusters: es behauptet ein ‚Herannahen und baldiges Überschreiten einer unumkehrbaren Sachverhaltsänderung, die fatale bzw. dystopische Folgeschäden auslöst, wenn nicht umgehend bestimmte Maßnahmen eingeleitet oder unterlassen werden.‘
Verfassung
Die Verfassung eines Landes (in Deutschland das Grundgesetz von 1949) steht für die höchste und letzte normative und Legitimität setzende Instanz einer staatlichen Rechtsordnung. In der offiziellen Version demokratischer Selbstbeschreibung ist es das Volk selbst, das sich in einem rituellen Gründungsakt eine Verfassung gibt.
Toxizität / das Toxische
Es ist nicht immer ganz eindeutig bestimmbar, was gemeint wird, wenn etwas als toxisch bezeichnet wird. Zeigen lässt sich zwar, dass sich die Bedeutung von ‚giftig‘ hin zu ‚schädlich‘ erweitert hat, doch die Umstände, unter denen etwas für jemanden toxisch, d. h. schädlich ist, müssen aus der diskursiven Situation heraus erschlossen werden.
Zivilgesellschaft
Im gegenwärtigen deutschen Sprachgebrauch werden so heterogene Organisationen, Bewegungen und Initiativen wie ADAC und Gewerkschaften, Trachtenvereine und Verbraucherschutzorganisationen, Umweltorganisationen und religiöse Gemeinschaften zur Zivilgesellschaft gezählt.
Demokratie
Der Ausdruck Demokratie dient häufig zur Bezeichnung einer (parlamentarischen) Staatsform und suggeriert die mögliche Beteiligung aller an den Öffentlichen Angelegenheiten. Dabei ist seine Bedeutung weniger eindeutig als es den Anschein hat.
Verschiebungen
Versicherheitlichung
In akademischen Kontexten wird Versicherheitlichung in Abgrenzung zu einem naiv-realistischen Sicherheitsverständnis verwendet. Dieses betrachtet Sicherheit als einen universell erstrebenswerten und objektiv feststellbaren Zustand, dessen Abwesenheit auf das Handeln von Akteuren zurückzuführen ist, die feindselig, kriminell, unverantwortlich oder zumindest fahrlässig agieren.
Ökonomisierung
Ökonomisierung wird in gegenwärtigen Diskursen in der Regel zur Bezeichnung von Prozessen verwendet, in denen die spezifisch wirtschaftlichen Funktions-Elemente wie Markt, Wettbewerb/Konkurrenz, Kosten-Nutzen-Kalküle, Effizienz, Gewinnorientierung in Bereiche übertragen werden, die zuvor teilweise oder ganz nach anderen Leitkriterien ausgerichtet waren
Moralisierung
Moralisierung verlagert Macht- und Interessenkonflikte in die Sphäre der Kommunikation von Achtung / Missachtung. Sie reduziert Ambivalenz zugunsten einer Polarisierung von gut und böse.
Konstellationen
Partizipatorischer Diskurs
Partizipation ist mittlerweile von der Forderung benachteiligter Personen und Gruppen nach mehr Beteiligung in der demokratischen Gesellschaft zu einem Begriff der Institutionen selbst geworden: Kein Programm, keine Bewilligung mehr, ohne dass bestimmte Gruppen oder Personen dazu aufgefordert werden, für (mehr) Partizipation zu sorgen.
Skandal
Die Diskurskonstellation des Skandals zeichnet sich durch eine in den Medien aufgegriffene (bzw. durch sie erst hervorgerufene) empörte Reaktion eines erheblichen Teils der Bevölkerung auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand aus. Die schuldhafte Verursachung dieses Missstandes wird dabei einem gesellschaftlichen Akteur zugeschrieben, dessen Handeln als ‚unmoralisch‘ gedeutet wird.
DiskursReview
Review-Artikel
Musk, Zuckerberg, Döpfner – Wie digitale Monopole die Demokratie bedrohen und wie könnte eine demokratische Alternative dazu aussehen?
Die Tech-Milliardäre Musk (Tesla, X,xAI) Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon) oder Pichai (Alphabet) sind nicht Spielball der Märkte, sondern umgekehrt sind die Märkte Spielball der Tech-Oligopolisten geworden.
Beobachtung zum Begriff „Diplomatie“ beim Thema Ukraine im Europäischen Parlament
Von EU-Vertretern waren zur Ukraine seit 2022 vor allem Aussagen zu hören, die sich unter dem Motto „as long as it takes“ beziehungsweise „so lange wie nötig“ für die Erweiterung der militärischen Ausstattung und der Verlängerung des Krieges aussprachen. Vorschläge oder Vorstöße auf dem Gebiet der „Diplomatie“ im Sinne von ‚Verhandeln (mit Worten) zwischen Konfliktparteien‘ gab es dagegen wenige, obwohl die klare Mehrheit von Kriegen mit Diplomatie beendet wurden (vgl. z.B. Wallensteen 2015: 142)
Die Macht der Worte 4/4: So geht kultivierter Streit
DiskursReview Die Macht der Worte (4/4):So geht kultivierter Streit Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...
Die Macht der Worte 3/4: Sprachliche Denkschablonen
DiskursReview Die Macht der Worte (3/4):Sprachliche Denkschablonen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...
Die Macht der Worte 2/4: Freund-Feind-Begriffe
DiskursReview Die Macht der Worte (2/4): Freund-Feind-Begriffe Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 /...
Die Macht der Worte 1/4: Wörter als Waffen
DiskursReviewDie Macht der Worte (1/4): Wörter als Waffen Begleittext zum Podcast im Deutschlandfunk (1) Wörter als Waffen (2) Freund-Feind-Begriffe (3) Sprachliche Denkschablonen (4) So geht kultivierter StreitEin Text vonvon Friedemann VogelVersion: 1.0 / 06.03.2025...
Relativieren – kontextualisieren – differenzieren
Die drei Handlungsverben relativieren, kontextualisieren, differenzieren haben gemein, dass sie sowohl in Fachdiskursen als auch im mediopolitischen Interdiskurs gebraucht werden. In Fachdiskursen stehen sie unter anderem für Praktiken, die das Kerngeschäft wissenschaftlichen Arbeitens ausmachen: analytische Gegenstände miteinander in Beziehung zu setzen, einzuordnen, zu typisieren und zugleich Unterschiede zu erkennen und zu benennen.
Wehrhafte Demokratie: Vom Wirtschaftskrieg zur Kriegswirtschaft
Weitgehend ohne Öffentlichkeit und situiert in rechtlichen Grauzonen findet derzeit die Militarisierung der ursprünglich als „Friedensprojekt“ gedachten EU statt.
Tagung 2025: „Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung und Delegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen
„Das geht zu weit!“ Sprachlich-kommunikative Strategien der Legitimierung undDelegitimierung von Protest in öffentlichen, medialen und politischen Diskursen Tagung der Forschungsgruppe Diskursmonitor Tagung: 04. bis 5. Juni 2025 | Ort: Freie Universität Berlin...
„Remigration“ – Ein Riss im Schleier der Vagheit. Diskursive Strategien rund um das Remigrationskonzept und die Correctiv-Recherchen
Die am 10. Januar veröffentlichte Correctiv-Recherche über ein rechtes Vernetzungstreffen in Potsdam sorgte für erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit und die größten Demonstrationen gegen Rechtsaußen seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Im Fokus der Kritik…
